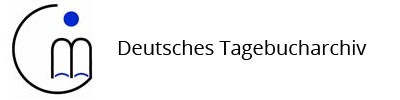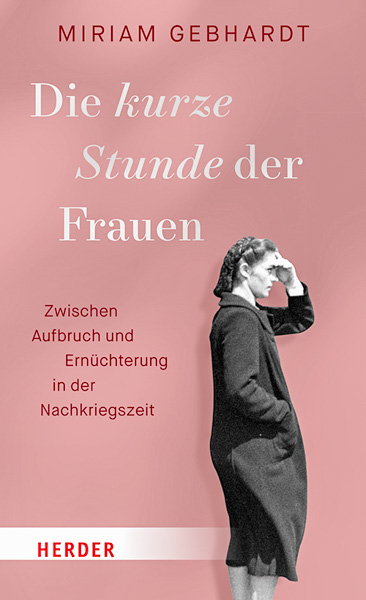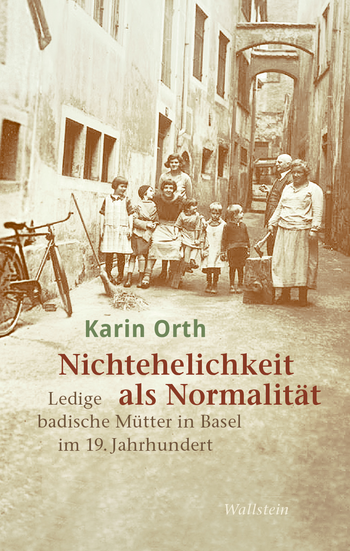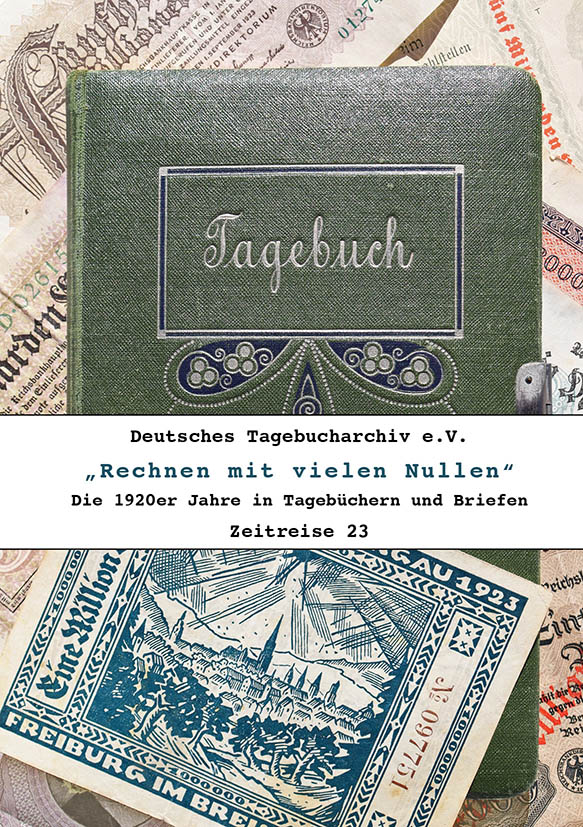Die kurze Stunde der Frauen
Das Jahr 1945 ist ein außerordentlicher Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Frauen wurden für ihre Stärke und ihre Existenzerhaltung in der Nachkriegszeit, ihre Aufbauarbeit als sogenannte Trümmerfrauen in der öffentlichen Darstellung sehr wertgeschätzt. Das Jahr wurde vielfach sogar als „Stunde der Frauen“ bezeichnet. Wie erlebten Frauen jedoch selbst die damalige Zeit? Welche Hoffnungen hegten sie? Wie erfuhren sie die belastenden Lebensumstände? Und was dachten sie, als die neu empfundene Freiheit bald wieder alten Machtverhältnissen weichen musste? Miriam Gebhardt beschreibt das Lebensgefühl deutscher Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg persönlich und mit Empathie. Dazu hat sie Selbstzeugnisse von Frauen ausgewertet, darunter rund zehn Tagebücher, Briefe und Erinnerungen aus dem DTA-Bestand. Sie zeigt, warum sich die meisten Frauen nicht aus alten Rollenmustern befreien konnten, wie es einigen gelang, neue Wege einzuschlagen – und wie diese Erfahrungen unser Leben bis heute beeinflussen. (Leseprobe)